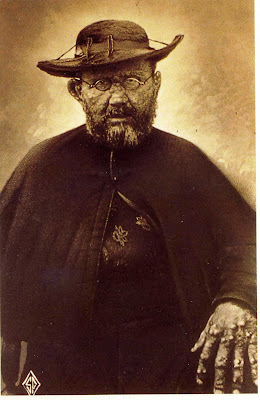In der Zeit stehen wir drinnen. Wie notwendig ist es, diese zwei Sakramente in sich zu tragen, das doppelte unauslöschliche Merkmal der Heiligsten Dreifaltigkeit, der Bruderschaft mit JESUS CHRISTUS. Wir tragen das ewige Antlitz der Heiligsten Dreifaltigkeit, den Widerschein dessen in uns. GOTT wollte, daß wir so weit in Ihn hineinreichen, als es überhaupt einem Geschöpf möglich ist; wie Adam nicht hineingereicht hätte. GOTT nimmt die Ursünde des Adam ernst und stellt als konträres Gegenteil nicht die Unschuld des Paradieses, sondern die Verwandtschaft mit dem Dreifaltigen GOTT und das Brudersein mit JESUS CHRISTUS. Das ist es eigentlich, was die christliche Seele ist und warum sie notwendig der Taufe und Firmung bedarf.
Im eigentlichen Sinn ist der unauslöschliche Charakter dem Priestertum eigen und bedeutet die tiefstmögliche Vereinigung mit dem opfernden Priester - eben das unauslöschliche Merkmal. Aber GOTT wußte auch Mittel und Wege, um auch die Gläubigen daran teilnehmen zu lassen. Und das ist das Merkwürdige, wenn es nicht Thomas gesagt hätte: Daß in jedwedem Sakrament, das natürlich der Priester vollzieht, jedweder Gläubige teilnimmt am Opfer CHRISTI und teilnimmt am opfernden CHRISTUS am Kreuz; und daß diesen Prozeß, der am Kreuze begonnen hat, jede getaufte Seele weiterführt und zur Vollendung führt, daß der Opfertod CHRISTI auf diese Weise in jeder Seele seine Vollendung erlebt. Die drei Sakramente lehren den Menschen, sich zu tiefst zu vereinigen, aus der Urfähigkeit, opfern zu können. Auch der Gläubige kann opfern.
Unser gläubiges Volk ist sich dessen ganz bewußt, daß es sich nichts mehr dabei denkt: "Geh, opfere das GOTT auf." Sagen Sie das einmal einem Ungetauften. Ist ja nicht möglich! Warum? Weil auch der Getaufte, der nicht Priester ist, am Opfercharakter teilnimmt. Ohne Priester zu sein, können diese Handlungen in die Opferhandlung CHRISTI einbezogen werden. Es kommt darauf an, daß wir mit Ihm in Beziehung stehen, und geben Sie acht: Ob Priester oder nicht Priester, der Getaufte ist nicht nur empfangend, er ist Mitopfernder, er nimmt am Opfer CHRISTI teil und kann für andere opfern. Das reine Wunder, das wir so gewohnt sind, daß es uns keinen Eindruck mehr macht.
Der Priester kann nur verwandeln, aber das Opferbringen in JESUS CHRISTUS kann jeder Getaufte und jeder Gefirmte. Darum ist Firmung so zu betonen, weil gerade Firmung die Beseligung im HEILIGEN GEISTE betont und getätigt hat.
Was also der Sinn der sieben Sakramente schlechthin ist, ist das Eine: Getauft zu sein und den Charakter bekommen zu haben, am Opfer CHRISTI aktiv in der Messe teilzunehmen und die Opfergaben weiterzuleiten und so den Kampf aufzunehmen, sodaß die Kraft so geballt ist wie möglich - darum die Notwendigkeit der Firmung. Wir sind so sehr daran gewöhnt, vom Taufcharakter zu sprechen, daß es uns keinen Eindruck mehr macht. Und gerade durch den Taufcharakter kann ich an den Früchten aus dem Opfer JESU CHRISTI teilnehmen und ohne dieses Prinzip wäre es unmöglich, die Leiden für einen anderen aufzuopfern. Ich bringe mich zum Opfer, ich lege es unmittelbar in CHRISTUS hinein und ER steuert es und leitet es weiter - das ist nur möglich mit Tauf- und Firmcharakter. Darum gehört Firmung so stark mit hinein, weil die Gnade der Taufe gerade den Zweck des Opferns und des Bekenntnisses unterstreicht und die Seele zutiefst getränkt wird.
1964